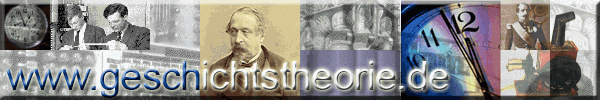
|
Diskurs als Kategorie I Diskurs ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einem der zentralen Begriffe der Theoriebildung geworden. Ähnlich wie bei anderen Grundbegriffen, die wie Gesellschaft oder Kultur als Kategorie verwendet werden, gibt es unterschiedliche Ansätze, den Begriff zu definieren. Einig sind sich alle Ansätze darin, dass Diskurs Wirklichkeit als ausschließlich oder wesentlich sprachlich verfasst begreift und dass diese Sprache nicht über eine Grammatik, sondern einen Sprachgebrauch definiert wird. Diskurs stammt vom lateinischen Begriff discurses ab, der das Auseinanderlaufen oder auch ein Hin- und Herbewegen bezeichnet. Ist der Begriff im französischen Alltagssprachgebrauch verankert und bezeichnet dort ein vernünftiges, strukturiertes Gespräch, so ist er im Deutschen erst durch die Rezeption französischer und angelsächsischer Forschungsliteratur zu einem verbreiteten Begriff geworden. Geht man im Anschluss an den linguistic turn von der Vorstellung aus, dass Wirklichkeit nur in ihrer Konstituierung durch Sprache von uns erlebt und gelebt werden kann, steht die Frage im Mittelpunkt, wie Sprache funktioniert. Der Begriff Diskurs bezeichnet diese Funktionsweise von Sprache. Vorstellen kann man sich diese, wenn man sich eine Seminarsituation vorstellt. Aufgrund des Seminarthemas gibt es einen Rahmen, in dem sprachliche Ereignisse, das Sprechen, geschehen können. Dennoch ist niemand in der Lage, vor einer Seminarsitzung anzugeben, was an sprachlichen Äußerungen geschehen wird. Es wird ein Ausgangspunkt gesetzt, an den sich ein weiteres Reden anschließt. Dieses zweite Sprechen schließt an das erste Sprechen an, kann aber auch im Nachhinein nicht deterministisch aus diesem abgeleitet werden. Es gibt eine Verbindung zwischen beiden. Insofern ist das zweite Sprechen nicht unabhängig vom ersten, hätte aber auch anders ausfallen können. Es ist kontingent, das heißt, es ist schlüssig, dass es so ausfällt, wie es geschieht, aber nicht notwendig. Es wäre auch ein anderes Sprechen möglich gewesen. Kontingenz ist eine wesentliche Eigenschaft von Diskursen. Eine weitere ist, dass es zu ihrer Analyse nicht der Annahme eines intentionalen Sprechers bedarf. Sprechen 3 findet im Anschluss an Sprechen 2 statt. Der Sprecher reagiert auf 2, aber es ist unwichtig, welche Intentionen 2 hatte. Einzig entscheidend ist, welche Intentionen Sprecher glaubt, bei Sprecher 2 wahrgenommen zu haben. Analog funktioniert Situation 4 im Anschluss von 3. In keinem der Fälle ist es wirklich wichtig, zu wissen, welche Intentionen einer der Sprecher oder Sprecherinnen hatte. Einzig entscheidend ist, dass Sprechen geschieht. Der Diskurs bezeichnet diese Aufeinanderfolge von Sprechhandlungen, deren Aneinanderanschließen sich nicht aus irgendeinem außerhalb ihrer selbst liegenden Faktor deterministisch ableiten ließe. Das immer wieder Aneinanderanschließen von Sprechen, wie in der Seminarsituation, oder von Schreiben, ist Wirklichkeit und schafft solche beständig neu. Man könnte nun, wie es der Strukturalismus getan hat, sich für die Struktur interessieren, die dem Sprechgeschehen von Diskursen zu Grunde liegt. Etwa in der Form, wie sich Sprachwissenschaft für eine Grammatik interessiert, die die Regeln, denen eine Sprache folgt, zusammenfasst. Aber Diskurstheorie ist ein poststrukturalistisches Denken. Solches Denken glaubt nicht daran, dass es eine Struktur gibt, die die Basis des Geschehens bildet. Es gibt immer eine Vielfalt von Möglichkeiten, wie ein Sprechen in einem Seminar an ein vorhergehendes Sprechen anschließen kann. Diskurstheorie interessiert sich nicht für das Gemeinsame an allem nachfolgenden Sprechen oder für das repräsentative, typische Folgesprechen, das einem anderen Sprechen folgt. Sie interessiert sich für die Unterschiedlichkeit der Möglichkeiten, die geschehen können. Sie interessiert sich für die Differenzen, die geschehen. Insofern referiert Diskurstheorie in der hier dargestellten Form auf ein differenztheoretisches Denken. Wenn dieses Geschehen des Sprechens prinzipiell offen ist, lautet die Frage, die man sich in Diskursanalysen stellt, welche Spannweite von Möglichkeiten, dass ein Sprechen einem anderen folgt, es gibt. Daher fällt im Kontext der Diskurstheorie häufig der Begriff des „Sagbaren“. Er beinhaltet die Frage danach, was in einer spezifischen Situation überhaupt gesagt werden kann, und wo epochal oder regional die Grenze dessen liegt, was als sprachliches Ereignis geschehen kann. Eine solche Bestimmung des Sagbaren und des Unsagbaren ist immer erst im nachhinein, als historische Untersuchung, möglich. Bewegt man sich innerhalb eines Diskurses, kann man dessen Grenze nicht sehen. Da alles, was möglich ist, das sprachliche Geschehen des Diskurses ist, gibt es keine Möglichkeit, außerhalb desselben zu sein, weil es außerhalb desselben keine Wirklichkeit gibt. Erst in einer historischen Analyse lassen sich die Grenzen eines Diskurses bestimmen. Nicht aber in der Form, dass ein zeitlich späterer Diskurs fortgeschrittener ist, und die vorherigen umschließt, sondern nur in der Form, dass dieser Diskurs anders ist. Seine Grenzen wiederum kann der Historiker oder die Historikern nicht sehen und die historische Analyse selbst findet wiederum in einem Diskurs statt, der seine eigenen Bedingungen von Wirklichkeitskonstitution schafft. Daher kann ein konsequent begründete diskurstheoretische Arbeit auch nicht nach Wahrheit, sondern nur nach einer im Rahmen eines spezifischen Diskurses stattfindenden Interpretation eines anderen Diskurses streben. Die Bedingungen des jeweils eigenen Diskurses lassen sich nicht hinreichend reflektieren, da sich keine Position außerhalb des Diskurses einnehmen lässt. Aber das eigene Sprechen über einen historischen Diskurs schließt wiederum an anderes Sprechen an, das sich im Rahmen des wissenschaftlichen Diskurses, zu dem das eigene Sprechen gehört, ereignet. |
|||
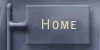 |
||
 |
||
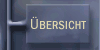 |
||
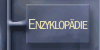 |
||
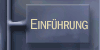 |
||
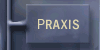 |
||
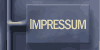 |
||
 |
||
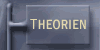 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
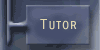 |
||