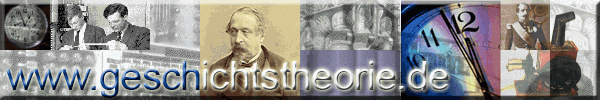
|
Diskurs als Kategorie II Für die Diskurstheorie gibt es zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt Diskurse auf unterschiedlichen Ebenen. Ein epochaler Diskurs, der alles Sprechen umfasst, ebenso wie begrenzte Diskurse, die wie die Diskurse einer Wissenschaft ihr eigenes Geschehen haben. Wo verschiedene Diskurse, die ansonsten relativ eigenständig funktionieren, sich berühren, entstehen Gemeinsamkeiten und Schnittmengen. Diese werden als Interdiskurse bezeichnet. Zusammenfassend lässt sich Diskurs als ein Sprachgeschehen definieren, das sowohl in gesprochener wie in geschriebener Form realisiert werden kann. Dieses Sprechen ist keine Reflexion von Wirklichkeit, sondern konstituiert die Wirklichkeit für den Diskurs. Dieser funktioniert als dynamisches Geschehen, das sich in der Zeit durch beständige, meist kleinste Verschiebungen, weiter bewegt. Der Grund, warum ein bestimmtes Sprechen an ein anderes anschließt, lässt sich nicht eindeutig logisch bestimmen. Es gibt immer auch die Möglichkeit, dass ein anderes Sprachgeschehen hätte geschehen können. Besonders die Diskurstheorie der 1960er und -70er Jahre und auch Michel Foucault, der als zentrale Gestalt der Entwicklung der Diskurstheorie angesehen wird, haben die Grenze dessen, was gesagt und was nicht gesagt wird, was in einer Gesellschaft als akzeptabler Anschluss an ein vorheriges Sprechen gilt und was nicht, als eine Frage der Macht interpretiert und durch kritische politische Analysen inhaltlich gefüllt. Die Subversivität, mittels der Diskurse funktionieren, haben aber ein Denken mit vorbereitet, das in den 1990er Jahren zunehmend dominant geworden ist, und in dem Macht als ein nur peripher mögliches, prinzipiell aber immer durch emergente und autopoietische Prozesse unterlaufenes Element der Wirklichkeit gedeutet wird. Stefan Haas |
|||
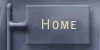 |
||
 |
||
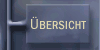 |
||
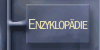 |
||
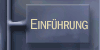 |
||
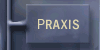 |
||
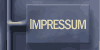 |
||
 |
||
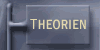 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
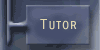 |
||