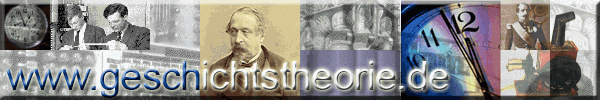
|
Der Russische Formalismus Russischer Formalismus heißt eine literaturtheoretische Schule, die um 1916 in Moskau und St. Petersburg entstand und im 20. Jh. die Theorieentwicklung in den Geisteswissenschaften maßgeblich beeinflusst hat. Sie gilt als wichtiger Wegbereiter des (Post-)Strukturalismus. Der Russische Formalismus verfolgte das methodische Ideal einer auf einem „exakten theoretischen Programm“ (Tynjanov/Jakobson) gegründeten, empirischen Wissenschaft. In der ersten Phase stand das Verfahren der Verfremdung im Mittelpunkt, wobei weniger die ethische oder ideologiekritische (wie später bei Brecht) als vielmehr die ästhetische Funktion im Vordergrund stand. Erst später wurden historische und gesellschaftliche Aspekte mit einbezogen, die im Entwurf eines formalistischen Modells der Literaturgeschichte gipfelten. Formalistische Konzepte lassen sich für kultur- und mentalitätsgeschichtliche Untersuchungen immer dann fruchtbar machen, wenn sich die Frage nach dem Verhältnis von Kunstwerken und ihrem soziokulturellen Umfeld stellt. Die formalistische Methode der Textinterpretation ist bemüht, strukturelle Gesetzmäßigkeiten des „literarischen Systems“ zu formulieren. In Abkehr von der romantischen Ästhetik gilt ein literarisches Werk daher schlicht als die „Summe künstlerischer Verfahren“, die darin angewandt werden. Da die Formalisten vor allem den konstruktiven Charakter der literarischen Sprache betonten, galt ihr Interesse hauptsächlich formalen Gestaltungsmustern; der Inhalt eines Werkes dient demnach nur der „Motivation“ literarischer Stilmittel. So wurde der (post-)moderne Textbegriff präfiguriert. Mit der Art und Weise, in der der Russische Formalismus die literaturimmanenten und die außerliterarischen Einflussfaktoren zueinander in Beziehung setzte, leistete er einen wichtigen Beitrag zur Literaturgeschichtsschreibung, insbesondere zur Frage der „relativen Autonomie“ der Literaturgeschichte (Kunst-/Musikgeschichte). „Dem Formalismus [seine] Einseitigkeit [...] zum Vorwurf zu machen, ist überflüssig, da er sie selbst betont. [...] Das Problem, das zu lösen wäre, besteht jedoch nicht darin, die Schwächen zu entdecken, sondern sie zu beheben, ohne die zentrale methodologische Idee preiszugeben: die Idee einer Geschichte der Kunst, die eine Geschichte der Kunst ist“ (Carl Dahlhaus). Erik Margraf/Modifikationen Herausgeberteam |
|||
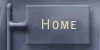 |
||
 |
||
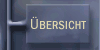 |
||
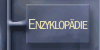 |
||
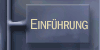 |
||
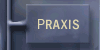 |
||
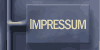 |
||
 |
||
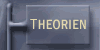 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
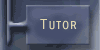 |
||