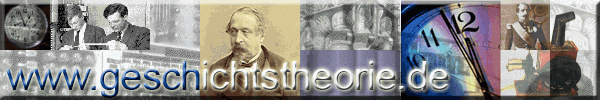
|
Das Grundproblem der Philosophie Schellings Schelling wird oft als der "Proteus der Philosophie" bezeichnet, also als ein Philosoph, der dauernd seine philosophische Position ändert. Dieses gängige Vorurteil wird dem tatsächlichen Gang seines Denkweges nicht gerecht, da er von seinen philosophischen Anfängen bis zu seinem Spätwerk an einem eigenen Grundgedanken festhält, den er allerdings in den verschiedenen Phasen seines Denkens variiert. Der Grundgedanke Schellings entwickelt sich innerhalb einer philosophischen Konstellation, deren drei Elemente die antike Ontologie (Platon/Aristoteles/Plotin), die rationalistische Metaphysik (Spinoza/Leibniz) und die moderne Transzendentalphilosophie (Kant/Fichte) sind. Diese unterschiedlichen philosophischen Strömungen versucht Schelling in einer Philosophie des Absoluten zu synthetisieren. Dieses Absolute soll als das Unbedingte das Prinzip eines Vernunftsystems sein. Mit dieser Bestimmung des Absoluten folgt er vor allem der monistischen Substanzmetaphysik Spinozas. Als kritischer Transzendentalphilosoph versucht Schelling gleichzeitig dieses Absolute durch den subjektphilosophischen Letztbegründungsgedanken des Ich zu begründen, womit er vor allem der "Wissenschaftslehre" Fichtes folgt. Die grundsätzliche Schwierigkeit dieses anspruchsvollen Programms einer letztbegründeten Philosophie des Absoluten besteht darin, dass sich dieses Absolute in einer Spannung zwischen Vernunftimmanenz und Vernunfttranszendenz bewegt. Das Grundproblem der Philosophie Schellings lässt sich als Frage folgendermaßen formulieren: Wie kann eine begründete Explikation des der Vernunft vorausliegenden Absoluten als Unbedingten stattfinden? Wird das Absolute in einer letztbegründeten Philosophie expliziert, so liegt es nicht mehr der Vernunft voraus, es verliert seine Vernunfttranszendenz. Wird das Absolute als ein der Vernunft vorausliegendes Unbedingtes anerkannt, so ist eine letztbegründete Philosophie nicht mehr möglich, das Absolute verliert seine Vernunftimmanenz. Mit dieser Aporie ringt Schelling sowohl in seiner Früh- als auch in seiner Spätphilosophie. Die Aktualität und Modernität der Philosophie Schellings liegt in der Explikation des Problems, dass das Andere der Vernunft zugleich auch das Prinzip der Vernunft sei. Neben Schopenhauer, Kierkegaard und Nietzsche eröffnet Schelling eine philosophische Diskussion, die zentral ist für das Denken des 20. Jahrhunderts: Die Philosophie des späten Heidegger, die Existenzphilosophie Jaspers', die "Negative Dialektik" Adornos und die "postmoderne" Rationalitäts-Debatte bewegen sich innerhalb eines Fragehorizontes, der durch die erwähnte Aporie Schellings bestimmt ist. Robert Jan Berg |
|||
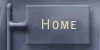 |
||
 |
||
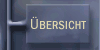 |
||
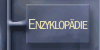 |
||
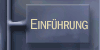 |
||
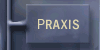 |
||
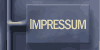 |
||
 |
||
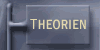 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
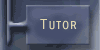 |
||