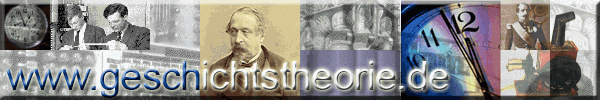
|
Strukturgeschichte: Praktische Folgen des materialen Strukturbegriffs in der Geschichtswissenschaft Innerhalb der Geschichtswissenschaft, die den Strukturbegriff häufig in seiner materialen Definition als überindividuelles Allgemeines verwendet hat und weniger in seiner formalen Bestimmung, werden häufig Satzkonstruktionen gesetzt, die solche Strukturen als aktives Subjekt des zu betrachtenden Prozesses ansetzen, beispielsweise in der Formulierung: „Die Gesellschaft veränderte sich“. Dies widersprach der ursprünglich in den systematischen Wissenschaften entwickelten Bedeutung des Begriffes Struktur. Dort war er ein formales Instrument, das für die jeweilige Einzeluntersuchung mit Inhalt gefüllt werden musste. Welche Struktur in einem bestimmten historischen Kontext herausgearbeitet werden konnte, war nicht im voraus zu entscheiden, sondern ergab sich erst im Dialog zwischen strukturalistischer Betrachtungsweise und den Quellen. Dies ließ ein flexibles Arbeiten zu. Die stärker auf den Inhalt setzende Begriffsbestimmung formuliert dagegen die jeweils dominant gesetzte Struktur als zentralen wirkungsmächtigen Bereich der Geschichte. In diesem Sinn kann Sozialgeschichte mit Gesellschaft als ihrer dominanten Struktur als zentrale Betrachtungsweise jeglicher Wirklichkeitsbetrachtung auftreten. In einer strukturhistorisch begründeten Geschichtstheorie – und nur in einer solchen, nicht in der jeder Sozialgeschichtsschreibung – werden diese Strukturen als Objekte der Erkenntnis verstanden: Geschichte ist dann primär Gesellschaft oder Kommunikation, je nachdem, welche Struktur als ein Allgemeinbegriff in den Mittelpunkt gestellt wird. Die Geschichte dieser Struktur, z.B. der Gesellschaft, wird dann vorrangig untersucht. Daneben wird diese im Mittelpunkt der Betrachtung stehende Struktur als das letzte, wirklichkeitsverursachende Prinzip der Geschichte angesehen. Wird beispielsweise Gesellschaft, wie dies in der klassischen Strukturgeschichte der 1960er und 1970er Jahre meist angenommen wurde, als zentrale Struktur gesehen, sind es gesellschaftliche Verhältnisse, von denen angenommen wird, dass sie die anderen Lebensbereiche bedingen und konstituieren. Damit wird diese Struktur zur zentralen geschichtsbildenden Kraft. Epochale Gliederungen werden dann entlang den Veränderungen der Struktur Gesellschaft vorgenommen. Jede neu angesetzte Epoche entspricht einem grundlegenden Wandel der Formation Gesellschaft. Diese Form der Strukturgeschichte war theoriegeschichtlich besonders dort heftig umstritten, wo sie auf das Individualitätsdogma des Historismus stieß. Die in diesem für Geschichte verantwortlich gemachten Individuen wurden von der Strukturgeschichte als Resultate spezifischer struktureller Bedingungen interpretiert und damit in ihrer Einmaligkeit relativiert. Schwierigkeiten gab es für diese Form der Strukturgeschichte dort, wo nicht historisch in einer Epoche bestehende Strukturen analysiert, sondern Wandel erklärt werden sollte. In der Philosophie, Soziologie oder Ethnologie entwickelte sich aus diesem Erklärungsnotstand der Poststrukturalismus aus dem Strukturalismus. Stefan Haas |
|||
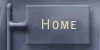 |
||
 |
||
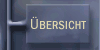 |
||
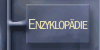 |
||
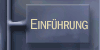 |
||
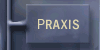 |
||
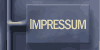 |
||
 |
||
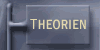 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
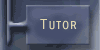 |
||