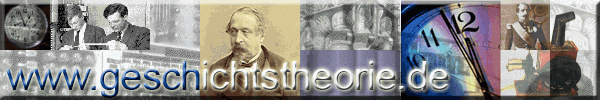
|
Elemente der Erkenntnis Ganz allgemein lässt sich über das, was wir Wissenschaft nennen, sagen: Wissenschaft formuliert Aussagen über etwas nach bestimmten Verfahren, die spezifischen Kriterien entsprechen müssen. Für die Wissenschaftstheorie sind dabei alle Faktoren fragwürdig, die in dieser Formulierung vorkommen. Wer formuliert, worüber wird etwas gesagt, was bedeutet dieses Sagen - Dies sind die drei Grundfragen der Wissenschaftstheorie. Daneben gibt es noch eine Reihe anderer, wichtiger Problemfelder: Wer hört zu? Welche Rolle spielt das Zuhören? Welches Verhältnis besteht zwischen Aussage und Ausgesagtem, zwischen Bezeichnendem und Bezeichnenten? Usw. Traditionellerweise ging man im 19. Jahrhundert davon aus, dass Wahrheit die Identität zwischen dem wissenschaftlichen Text und der gemeinten Empirie ist (vgl. Historismus). Man glaubte, dass es nur eine wichtige Frage der Theorie gebe: was ist das, worüber etwas gesagt wird. Das Subjekt galt als vernachlässigbar, sichtbar in Rankes Diktum vom „Auslöschen des Selbst“ im Erkenntnisprozess. Die Sprache, in der Wissenschaft formuliert wird, galt es neutrales Medium, in dem prinzipiell eine Bedeutung, die ich aussagen will, auch beim Zuhörer ankommt. Hier einen Link auf Grafik 1: Wahrheitsmodell des Historismus einbauen Mehrere Faktoren führten im 20. Jahrhundert zur Aufgabe eines Abbildrealismus in der Wahrheitstheorie (das Ausgesagte entspricht bzw. ist das Abgebildete, zwischen beiden besteht ein Identitätsverhältnis): - Die Einsicht in den Eigenwert der Sprache, d.h. dass Sprache selbst einen kreativen Anteil an der Aussage hat und nicht ein neutrales Medium ist. - Die Einsicht in die Eingriffsmöglichkeiten des Subjekts. Dieses setzt selbst die Grenzen eines Erkenntnisprozesses, sie werden nicht vom untersuchten Objekt bestimmt. Hierfür war die Rezeption von Kants Erkenntnistheorie wichtig, wie sie insbesondere von Dilthey und dem Neukantianismus seit den 1880er Jahren betrieben wurde. - Die nach wie vor vorhandene Strittigkeit der Wahrheit einzelner Aussagen. Aufgabe war es also, die Rolle des Erkenntnissubjekts in den Mittelpunkt der Erkenntnistheorie zu stellen. Hierfür gibt es prinzipiell zwei Wege, wie Wissenschaftsprozesse sortiert werden können: einmal nach der Quantität des Erkenntnissubjekts, einmal nach seiner Qualität. Stefan Haas |
|||
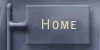 |
||
 |
||
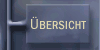 |
||
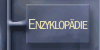 |
||
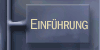 |
||
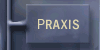 |
||
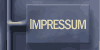 |
||
 |
||
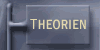 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
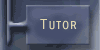 |
||