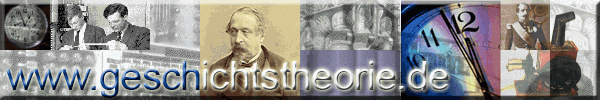
|
Jürgen Habermas - Biographie Jürgen Habermas gehört zu den einflussreichsten deutschsprachigen Philosophen des letzten Drittels des 20. Jahrhunderts. Er hat seine Ursprünge in der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule, entwickelte aber über diese hinausgehend ein breites Oeuvre philosophischer, ethischer und politischer Arbeiten. Seine Bekanntheit reicht aufgrund seines publizistisch-politischen Engagements weit über das Fachpublikum hinaus. Es war nicht zuletzt sein Artikel Eine Art Schadensabwicklung, der 1986 den sogenannten Historikerstreit zur Unmöglichkeit einer Relativierung der NS-Verbrechen auslöste. Habermas wurde am 18. Juni 1929 in Düsseldorf geboren. Er studierte Philosophie, Geschichte, Psychologie, Deutsche Literatur und Ökonomie in Göttingen, Zürich und Bonn. 1954 promovierte er dort mit einer Arbeit über Schelling bei dem sich als Nachfolger Diltheys verstehenden, als Geschichtstheoretiker und Kulturanthropologe bekannt gewordenen Erich Rothacker. 1956 ging er an das Institut für Sozialforschung in Frankfurt/Main, wo er Assistent von Theodor W. Adorno wurde. Seine Habilitation verlief allerdings problematisch. Max Horkheimer waren seine Arbeiten zu politisch, aus diesem Grunde wollte er Habermas nicht an das Institut binden. Somit habilitierte sich Habermas 1961 in Marburg bei dem Sozialwissenschaftler Wolfgang Abendroth mit einer Arbeit zum Strukturwandel der Öffentlichkeit, die heute als Klassiker der Forschung auf diesem Sektor gilt. Im selben Jahr wurde Habermas auf Initiative Hans-Georg Gadamers und Karl Löwiths als außerordentlicher Professor nach Heidelberg berufen. 1964 kehrte er nach Frankfurt zurück, und übernahm den Lehrstuhl Horkheimers, was ihn trotz der ehemaligen Bedenken wieder deutlich sichtbar zum Mitglied der Frankfurter Schule machte. Habermas engagierte sich in den politischen Reformbewegungen der späten 1960er Jahre, ging 1971 an das „Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt“ nach Starnberg, dessen Leiter er neben dem Physiker und Philosophen Carl-Friedrich von Weizsäcker war und wechselte 1980 für zwei Jahre an das „Max-Planck-Institut für Sozialwissenschaften“ nach München. Sichtbarer Ausdruck des Versuchs, Philosophie und Sozialwissenschaften zu einer fruchtbaren Synthese zu vereinen, ist auch sein in dieser Zeit entstandenes Hauptwerk Theorie des kommunikativen Handelns, das erstmals 1981 erschien. 1982 ging er als Philosophieprofessor zurück nach Frankfurt/M., wo er bis zu seiner Emeritierung 1994 lehrte. Die breite Anerkennung seiner Arbeiten schlägt sich auch in wichtigen Preisen nieder, u.a. erhielt er 1973 den Hegel-Preis der Stadt Stuttgart, 1976 den Sigmund-Freud-Preis, 1980 den Theodor W. Adorno-Preis der Stadt Frankfurt und 1986 den Leibniz-Preis.
|
|||
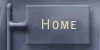 |
||
 |
||
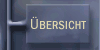 |
||
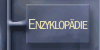 |
||
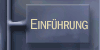 |
||
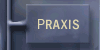 |
||
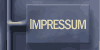 |
||
 |
||
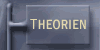 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
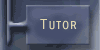 |
||