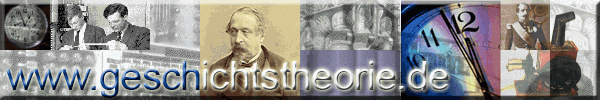
|
Historismus als philosophische Position (Historizismus) Der Begriff ‚Historismus’ bezeichnet, neben einer Richtung innerhalb der empirischen Geschichtswissenschaft, eine philosophische Grundeinstellung, die Fragen nach einer Sache prinzipiell durch ein Eingehen auf die zeitliche Entstehung des Nachgefragten beantwortet. Eine Rechtswissenschaft, die im philosophischen Sinn historistisch verfährt, wird auf Fragen nach dem Wesen und dem Sinn einer bestimmten Rechtsauffassung oder Rechtspraxis die historische Entstehung dieser Auffassung oder Praxis untersuchen. In dieser historischen Entwicklung sieht sie den Sinn und die Legitimität einer bestimmten Rechtspraxis. In einer Form gab es im 19. Jahrhundert innerhalb der Rechtswissenschaft eine lange Zeit dominierende Historische Rechtsschule. Ebenso wird eine historistisch orientierte Sozialwissenschaft, die fragt, was Gesellschaft ist, nicht die Utopie der bestmöglichen Gesellschaft erarbeiten, sondern die Geschichte der bestehenden Gesellschaft erzählen. Durch diese Rückbindung an die historische Entwicklung ist der philosophische Historismus strukturell konservativ. Er kann aber auch progressiv auftreten, wenn er eine entwickelte Rechtspraxis gegen eine von außen, beispielsweise einem Usurpator eingesetzte neue Rechtspraxis verteidigt oder gegen Fehlentwicklungen einer solchen Praxis die Wiedereinführung historisch gültiger Rechtspraktiken fordert. Die Funktionsweise des philosophischen Historismus lässt sich auch am Beispiel der Architektur verdeutlichen. Architekten, die sich fragen, wie ein bestimmter Bauauftrag zu gestalten ist, und die historistisch denken, werden Antworten aus dem bestehenden historischen Kanon an Bauformen heraus formulieren. Sie werden versuchen, historische Bauformen zu optimieren, aber sie werden nicht den Wunsch verspüren, einen eigenen Stil zu erschaffen. Vielmehr sehen sie gerade in der Anknüpfung an historische Formen die Gewähr für eine wahre Architektur, die organisch mit dem Leben ihrer Benutzer verbunden ist. Solche Formen historistischer Architektur hat es im 19. Jahrhundert vielfach gegeben (Neogotik, Neoromanik, Neobarock, Neorenaissance). Ihr Ziel war es, das Eingebundensein in die eigene Geschichte zu bauen. Die Gegenbewegungen der Jahrhundwende des Jugendstils, Modernismo oder Art nouveau erklären sich aus der Ansicht der jungen Architekten, dass mit Industrialisierung und Urbanisierung eine neue Epoche angebrochen sei, die eine neue Formensprache bedarf. Der philosophische Historismus oder Historizismus neigt zur Betonung der Kontinuitäten, der Antihistorismus zur Betonung der Brüche, der Diskontinuitäten. Der Historismus wird auf die Frage, was der Mensch ist, seine Geschichte erzählen. Antworten wie ‚Der Mensch ist ein vernunftbegabtes Wesen’ (Aristoteles) sind nicht historistisch, weil sie ein allgemein überzeitliches Prinzip, eine anthropologische Konstante, über die Geschichte stellen. Der Historismus der Historiker hat viel von dieser Position. Er widerspricht sich aber da, wo er hermeneutisch arbeitet, d.h. im Sinn von Droysen und Dilthey sich in die historische Persönlichkeit hineindenken will und damit zwangsläufig eine Wesensgleichheit des Menschen über die Geschichte hinweg annehmen muss. Insofern ist der Historismus als dominierende Denkform der empirischen historischen Wissenschaften des 19. Jahrhunderts zwar ein philosophischer Historismus, aber nicht jeder philosophische Historismus teilt zugleich die Erkenntnistheorie des Historismus. Eine Position, die zwar Elemente des philosophischen Historismus enthält, aber zugleich gegen den geschichtswissenschaftlichen Historismus eingesetzt wird, ist die Diskurstheorie von Michel Foucault. Er hat gegen einen rein auf anthropologische Konstanten setzenden Ansatz des Strukturalismus die historische Entwicklung und die Differenzen in der Geschichte als wesentlich herausgestellt, mit der Diskurstheorie aber eine gänzlich vom Historismus unterschiedene Methode erarbeitet. Stefan Haas |
|||
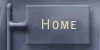 |
||
 |
||
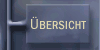 |
||
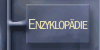 |
||
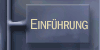 |
||
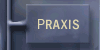 |
||
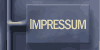 |
||
 |
||
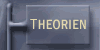 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
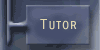 |
||